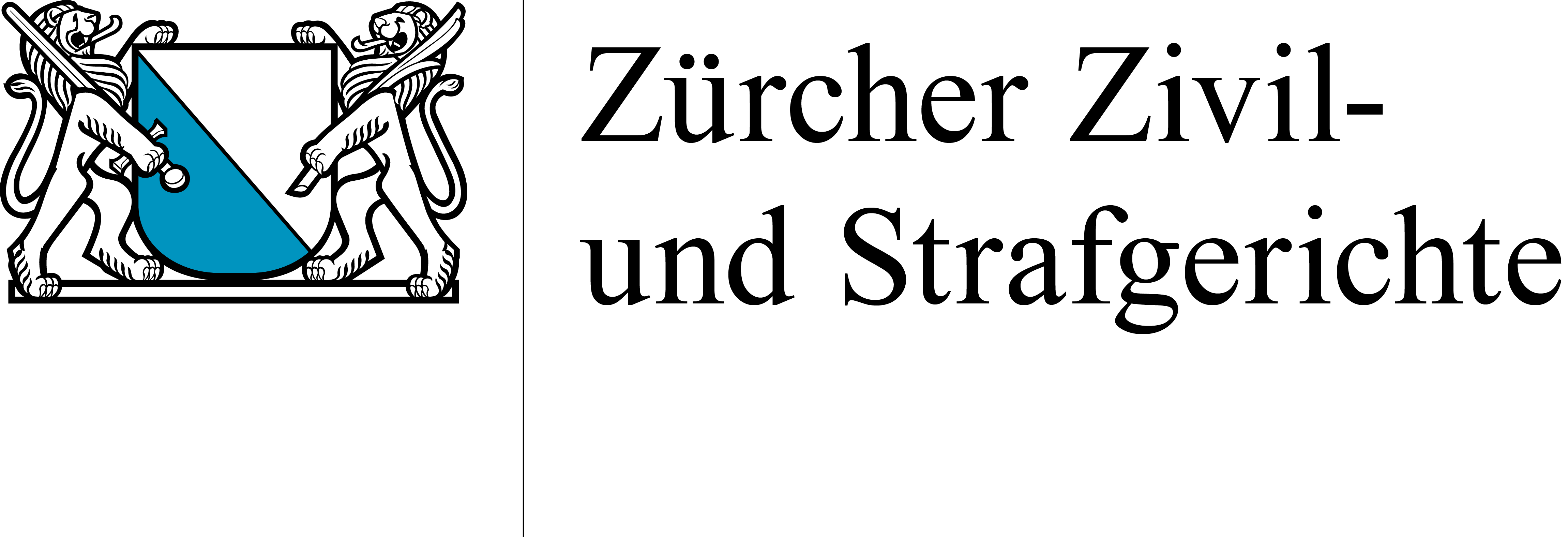Online-Informationen zu rechtlichen Themen
Auf unserer Website finden Sie Hinweise zu den wichtigsten Themengebieten, mit welchen sich unsere Zivil- und Strafgerichte befassen. Darüber hinaus bieten wir Ihnen zahlreiche Merkblätter, Checklisten, Musterbriefe und -konventionen sowie Klageformulare an. Benützen Sie zur Auswahl des Themas bitte die Navigationsleiste auf der linken Seite.
Wichtige Hinweise
- Speichern Sie die Formulare lokal auf Ihrem Computer.
- Verwenden Sie für das Ausfüllen das Programm Acrobat Reader
(kann unter https://get.adobe.com/de/reader/ heruntergeladen werden).
Achtung: Das Programm muss lokal auf dem Computer installiert sein.
Das Ausfüllen im Browser wird generell nicht empfohlen.
Elektronischer Rechtsverkehr
Eingaben können den Gerichten auch elektronisch zugestellt werden. Es gelten folgende Voraussetzungen:
- Dokumente in PDF-Format
- qualifizierte elektronische Signatur (E-Government bei Innosuisse: elektronische Signaturen,
Liste der zugelassenen elektronischen Signaturen)
- Übermittlung über anerkannte Zustellplattform (www.privasphere.com, www.incamail.com.)
Die Modalitäten des elektronischen Rechtsverkehrs sind in der Übermittlungsverordnung und im Reglement des Obergerichts betreffend elektronischer Rechtsverkehr im Zivil- und Strafprozess geregelt. Auf der Webseite des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements können Sie sich umfassend informieren. Nähere Angaben zu den anerkannten Zustellplattformen finden Sie unter
e-Justice.
Bitte beachten Sie, dass eine elektronische Zustellung an ein Gericht nur über eine anerkannte Plattform für sichere Zustellungen im Sinne der erwähnten Verordnung gültig vorgenommen werden kann. Zustellungen über den Weg eines normalen oder elektronisch signierten E-Mails müssen zurückgewiesen werden und entfalten keine Rechtswirkung.
Fax
Eingaben per Fax sind nicht zulässig. In dringenden Fällen können Eingaben per Fax dem Gericht eine ordentliche Eingabe ankündigen. Aus Gründen des Prozessrechts muss die entsprechende Eingabe aber auch immer per Post (mit eigenhändiger Unterschrift) oder elektronisch (mit qualifizierter elektronischer Signatur) und innert der allenfalls laufenden Frist eingereicht werden. Fax-Sendungen ohne nachfolgende ordentliche Eingabe entfalten keine Rechtswirkung.